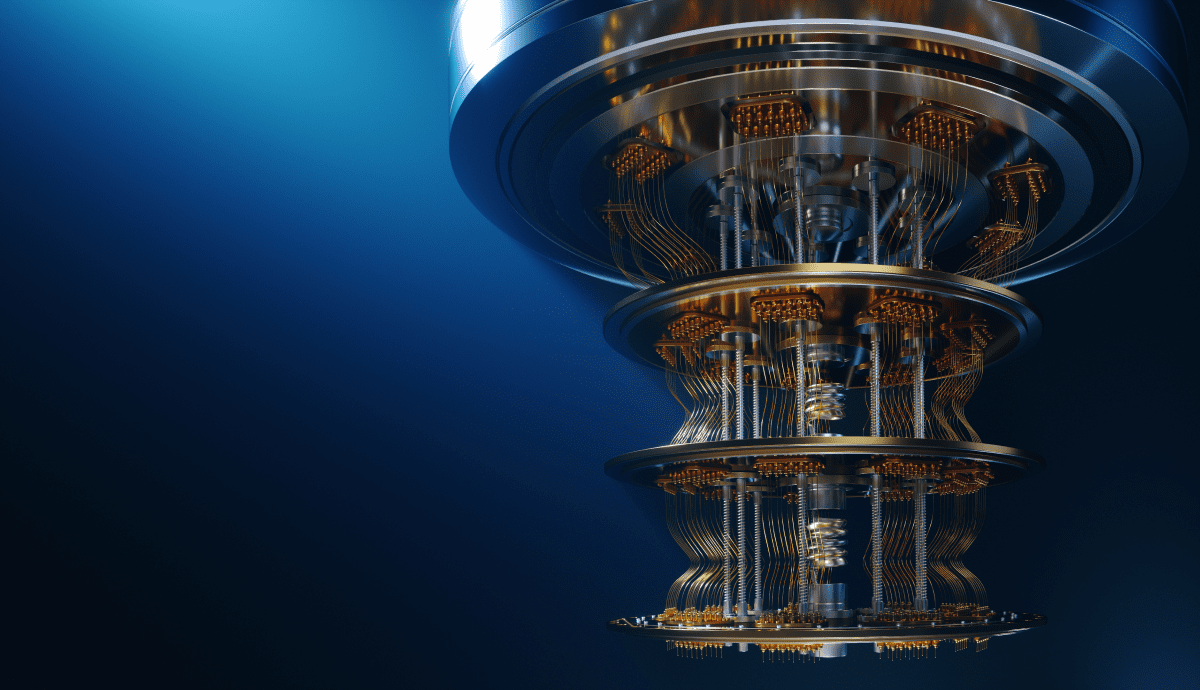Quantencomputing klingt oft nach Science-Fiction, nach einer Zukunft, die noch weit entfernt ist. Doch mehr und mehr Fachleute betonen: Die Zukunft kommt schneller, als man denkt und wer die Technologie verstehen und nutzen will, muss sich heute vorbereiten. Warum das gerade für Verwaltungen relevant ist, welche konkreten Anwendungen es schon gibt und wie Fsas Technologies hier unterstützt, darüber haben wir mit Anne-Marie Tumescheit, Strategic Technology Consultant (Quantum & AI), Fsas Technologies und Dirk Ullmann, Client Executive Landesbehörden Berlin/Brandenburg gesprochen.
Quantencomputing in der Verwaltung
Frau Tumescheit, Quantencomputing ist aktuell in aller Munde. Warum sollten sich auch Verwaltungen generell damit befassen?
Quantencomputer sind keine Ersatztechnologie für klassische Rechner. Sie werden diese nicht ablösen, sondern ergänzen – mindestens die nächsten Jahrzehnte. Denn für viele alltägliche Aufgaben wie Datenaufbereitung oder typische IT-Systeme sind sie schlicht ungeeignet.
Aber bei Anwendungsfällen, die sogenannten NP-harten Probleme enthalten – also komplexen Fragestellungen, für die wir bislang keine schnellen Algorithmen kennen – können Quantencomputer ihre Stärken ausspielen. Dazu gehören zum Beispiel Optimierungsprobleme. Man kann sich das in einer Verwaltung sehr konkret vorstellen: die Planung von Touren in der Grünpflege, die Einsatzplanung von Fahrzeugen oder die optimale Verteilung von Ressourcen. Mit Quantencomputing lassen sich solche Aufgaben effizienter und schneller lösen, sodass Mitarbeitende ihre Zeit besser nutzen können.
Darüber hinaus eröffnen Quantencomputer neue Möglichkeiten bei Simulationen. Denken Sie an Starkregenszenarien, Klimamodelle oder an die Frage, wie sich unterschiedliche Begrünungsmaßnahmen in einer Stadt langfristig auswirken. Aber auch jenseits von Smart-City-Anwendungen sind Simulationen relevant – etwa bei der Analyse und Eindämmung von Krankheitsausbrüchen, beispielsweise in der Viehhaltung oder Tierzucht, wo es darum geht, Ausbreitungswege von Erregern vorherzusagen und Gegenmaßnahmen zu planen.
Nicht zuletzt ist der frühe Einstieg entscheidend für den Kompetenzaufbau. Nur wenn Verwaltungen sich jetzt mit der Technologie beschäftigen, können sie später souverän beurteilen, welche Lösungen sinnvoll sind, tatsächlich Vorteile generieren – und vermeiden, von einzelnen Anbietern abhängig zu werden.

Man könnte sagen, das klingt doch nach Zukunft. Warum ist es für Verwaltungen wichtig, schon jetzt zu handeln?
Es gibt gleich mehrere Gründe, frühzeitig einzusteigen. Erstens ermöglicht es den Aufbau von Kompetenzen und Governance. Quantencomputing ist keine Technologie, die man an einem Nachmittag versteht. Wer heute beginnt, schafft die Grundlagen, um mitreden zu können – fachlich und strategisch. Außerdem kann dieses Wissen die eigenen Digitalstrategie enorm bereichern.
Zweitens geht es um digitale Souveränität. Wenn Verwaltungen zu lange warten, laufen sie Gefahr, irgendwann nur noch Konsumentinnen und Konsumenten fremder Lösungen zu sein, die sie vielleicht nicht gut verstehen. Wer früh handelt, kann mitgestalten – wer mitgestaltet ist weniger abhängig.
Drittens spielt das Thema IT-Sicherheit eine wichtige Rolle. Schon heute sehen wir Angriffe nach dem Prinzip „Harvest now, decrypt later“: Daten werden jetzt abgegriffen, um später mit leistungsfähigeren Technologien entschlüsselt zu werden. Auch wenn es vermutlich noch fünf bis zehn Jahre dauert, bis Quantencomputer aktuelle Verschlüsselungsverfahren brechen können – die Daten, die heute gespeichert werden, sind dann immer noch wertvoll und gefährdet. Hier müssen Verwaltungen vorbereitet sein, indem sie Post-Quantum-Kryptografie einsetzen und ihre Systeme idealerweise kryptoagil aufstellen.
Und schließlich sendet eine Verwaltung, die in Quantencomputing investiert, auch ein klares Signal – nach innen und nach außen. Sie zeigt Bürgerinnen und Bürgern, dass sie Zukunftstechnologien ernst nimmt, positioniert sich als attraktiver Arbeitgeber und stärkt das lokale Ökosystem aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.
Möglichkeiten und Chancen
Können Sie konkrete Anwendungsbeispiele nennen, die schon heute für Verwaltungen interessant sind?
Sehr gerne. Ein Klassiker sind Optimierungsprobleme: die Planung von Touren, Personal- und Ressourceneinsatz. Ich fass noch mal die Grünpflege einer Stadt auf und deren Organisation. Hier geht es darum, Menschen, Maschinen bzw. Geräte und Fahrzeuge so einzusetzen, dass möglichst viele Aufgaben in der gegebenen Zeit erledigt werden – und das mit minimalen Fahrzeiten.
Ein zweiter spannender Bereich ist die Schulplatzvergabe. Normalerweise entscheidet der Einzugsbereich. Aber wenn man weitere Faktoren berücksichtigt – etwa Elternwünsche, Fachangebote der Schulen oder Arbeitswege – wird es schnell komplex. Mit quantenbasierten Optimierungen könnten Kommunen eine effizientere Verteilung erreichen.
Auch Verkehrssimulationen sind ein starkes Anwendungsfeld. Planerinnen und Planer können mithilfe von Quantencomputing nicht nur aktuelle Verkehrsflüsse analysieren, sondern auch Szenarien durchspielen: Was passiert, wenn eine neue Baustelle entsteht? Welche Umleitungen sind sinnvoll? Wie muss ich den Verkehr lenken, damit weniger Staus oder „Stop & Go“ Situationen entstehen, beispielsweise auch über eine kollaborative Ampelsteuerung. So lassen sich Staus und Belastungen verringern, bevor sie entstehen.
Darüber hinaus gibt es Anwendungen im Bereich Klima und Umwelt: von Starkregensimulationen bis zu langfristigen Fragen wie Wassermanagement oder Aufforstungsstrategien. Solche Szenarien sind für viele Kommunen zentral, um klimaresilient zu werden.
Wichtig ist allerdings: Quantencomputing lohnt sich vor allem, wenn die Probleme groß und komplex sind. Eine kleine Gemeinde mit zwei Kindergärten kann die Verteilung der Kinder auch weiterhin mit Papier und Stift planen. Doch schon bei 10 Mitarbeitenden in der Grünpflege mit verschiedenen Kompetenzen, entsprechenden Fahrzeugen und Geräten und vielzähligen Aufgaben, wird es schnell komplex. Also immer dort, wo viele Variablen und Interessen berücksichtigt werden müssen, spielen Quantencomputer ihre Stärken aus.
Sie haben das Thema Sicherheit schon angesprochen. Wie wichtig ist das in Bezug auf Quantencomputing?
Es ist eines der zentralen Themen – und es ist nicht optional. Sobald Quantencomputer eine gewisse Größe erreicht haben, können sie gängige Verschlüsselungsverfahren brechen. Für Verwaltungen bedeutet das: Melderegister, Gesundheitsakten, Infrastrukturdaten oder Baupläne wären in Zukunft angreifbar.
Das Problem ist, dass Angreifer schon heute Daten abgreifen und später entschlüsseln können. Das zuvor angesprochene Prinzip nennt man „Harvest now, decrypt later“. Selbst wenn die Daten aktuell sicher scheinen, könnten sie in wenigen Jahren offengelegt werden. Deshalb müssen Verwaltungen jetzt handeln und ihre Systeme quantensicher machen.
Die Lösung heißt Post-Quantum-Kryptografie (PQC). Dabei werden Algorithmen eingesetzt, die auch von Quantencomputern nicht geknackt werden können. Oft kombiniert man klassische und quantensichere Verfahren zu einem hybriden Modell oder nutzt einen Algorithmus, der beidem standhält – das hängt auch von der Leistungsfähigkeit des verschlüsselnden Systems ab. Ergänzend spielt Kryptoagilität eine wichtige Rolle. Das bedeutet, Verschlüsselungssysteme so modular aufzubauen, dass sich Algorithmen im Zweifelsfall wie Bausteine austauschen lassen.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und auch internationale Gremien geben hier bereits Empfehlungen und Standards vor. Verwaltungen, die jetzt mit der Umstellung beginnen, sichern ihre Daten langfristig ab und vermeiden später hohe Kosten.
Quantencomputing bei Fsas Technologies
Wo kommt Fsas Technologies bei diesem Thema ins Spiel?
Wir verstehen uns als Partner, der Verwaltungen beim Einstieg in Quantencomputing berät und unterstützt. Um das nachhaltig tun zu können, engagieren wir uns in nahezu allen Bereichen des Technologie-Stacks:
Hardware
Aktuell arbeiten wir stark mit supraleitenden Quantencomputern und veröffentlichten unser System mit 256 Qubits gemeinsam mit Riken im April diesen Jahres. 2026 werden es 1.024 Qubits, also das Ziel ist es, in den kommenden Jahren deutlich zu skalieren – bis hin zu über 10.000 Qubits. Parallel forschen wir an alternativen Ansätzen, zum Beispiel diamantbasierten Quantencomputern.
Software
Wir entwickeln Methoden zur Fehlerkorrektur, Betriebssysteme wie „Oktopus“ und Quanten-Simulatoren. Letztere sind entscheidend, um die Technologie praxisnah weiterzuentwickeln.
Anwendungen
Mit dem Digital Annealer können wir bereits heute kombinatorische Optimierungsprobleme lösen, die in klassischen Architekturen sehr aufwendig wären. Das ist für Verwaltungen besonders interessant, da sich damit konkrete Probleme wie Ressourcen- oder Verkehrsplanung adressieren lassen. Aber auch auf der 256 Qubit Maschine führen wir gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Forschung bereits Anwendungsfälle aus.
Kooperationen
Wir arbeiten eng mit Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen – in Japan, Europa und speziell auch in Deutschland. Damit stellen wir sicher, dass unsere Lösungen nicht im Labor bleiben, sondern nah an den praktischen Bedürfnissen entwickelt werden.
Für Verwaltungen heißt das: Sie müssen keine eigene Forschungsabteilung aufbauen, sondern können mit uns Pilotprojekte starten und so Schritt für Schritt Erfahrung sammeln und für sich feststellen, welche Kompetenzen Sin in der Zukunft brauchen.

Ein Highlight war jüngst das 3. Innovationsforum Berliner Verwaltung. Herr Ullmann, Sie haben die Veranstaltung begleitet. Können Sie uns einen Einblick geben?
Sehr gerne! Beim Innovationsforum haben wir gemeinsam mit den Teilnehmern und hochkarätigen Vortragenden einen praxisnahen Blick auf Quantencomputing geworfen – von der Funktionsweise über die Anwendungsfelder bis hin zu Sicherheitsaspekten und dem Berliner Ökosystem.
Wir waren damit sehr nah an der Praxis der Berliner Verwaltung, denn auch hier bietet Quantencomputing die Chance, komplexe gesellschaftliche Herausforderungen schneller und effizienter zu lösen. Neben den Themen, die Anne-Marie gerade schon angesprochen hat, gab es außerdem einen Überblick über die aktuellen Landesinitiativen für Quantentechnologien in Berlin und das breit aufgestellte Ökosystem aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung in der Hauptstadtregion. Darüber hinaus wurde beleuchtet, wie sich Quantencomputing bereits heute auf die Cybersicherheit und insbesondere auf die Kryptografie auswirkt.
Wie relevant dieses Thema ist, zeigte sich auch in den Reaktionen der Teilnehmenden: Besonders beim letzten Thema wurde deutlich, dass Quantencomputing auf breiter Ebene praktische Relevanz hat und nicht länger nur ein abstraktes Forschungsthema ist.
Für mich steht fest: Quantencomputing ist keine Science-Fiction! Die technischen Entwicklungen schreiten immer schneller voran, und die Anwendungsmöglichkeiten werden zunehmend greifbar. Daher sollte sich auch die öffentliche Verwaltung verstärkt mit dem Thema auseinandersetzen. Wer früh handelt, schafft digitale Souveränität für morgen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Ausblick: Möchten Sie mehr über das 3. Innovationsforum Berliner Verwaltung erfahren? Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf unserer Webseite – oder hier im Highlight-Video.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.